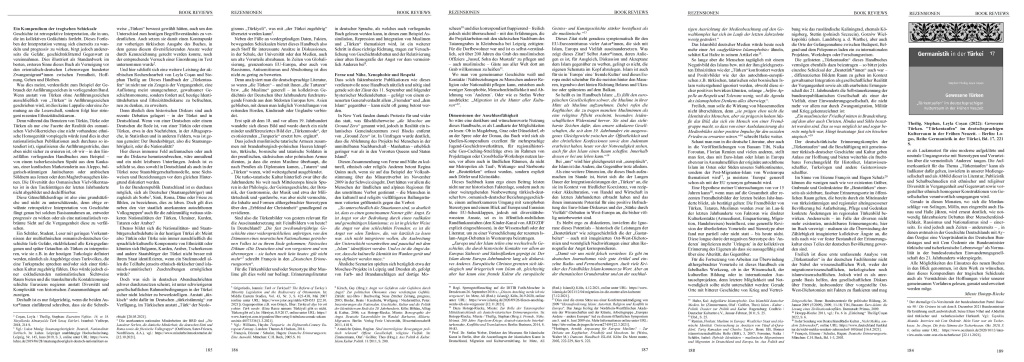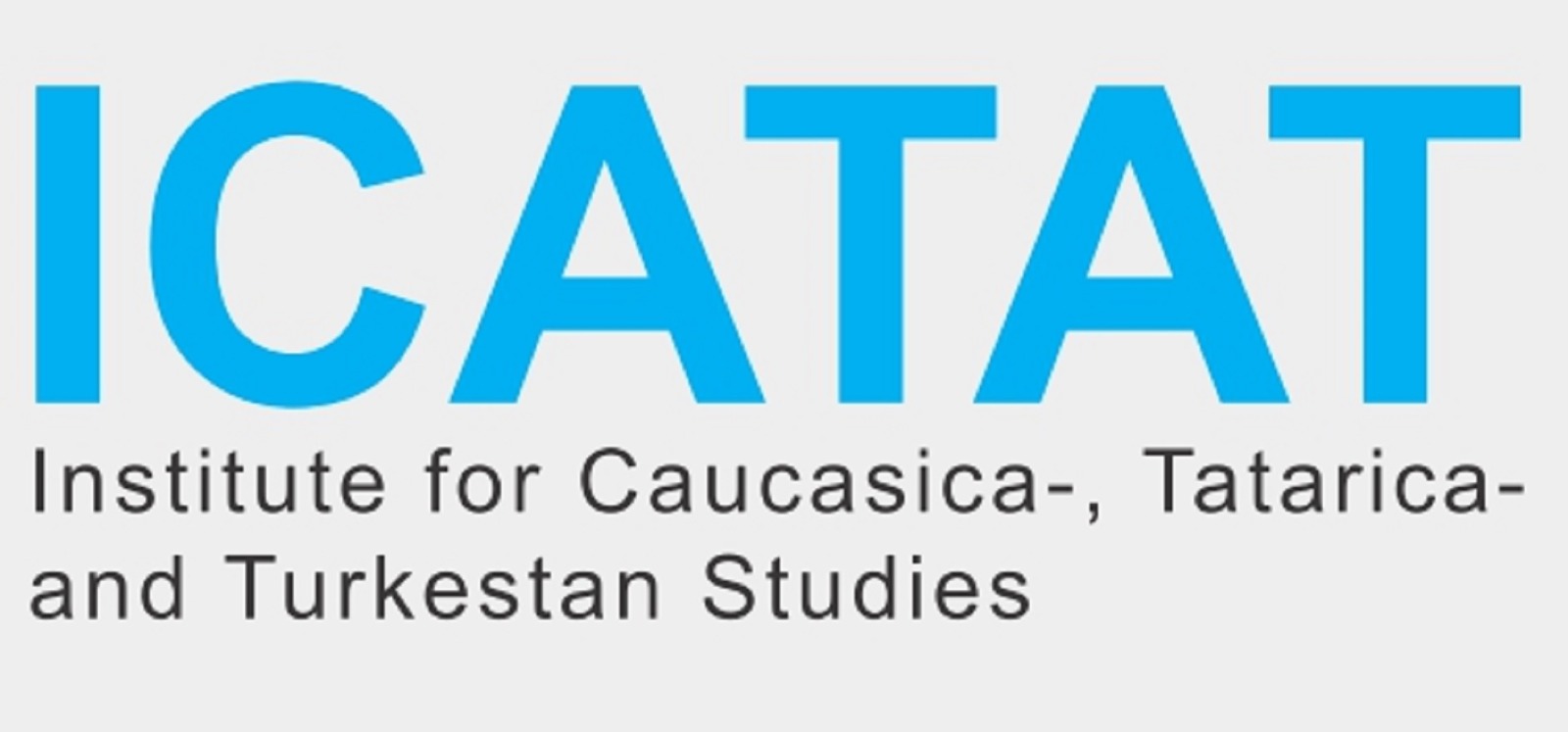Theilig, Stephan / Coşan, Leyla: Gewesene Türken. „Türkentaufen“ im deutschsprachigen Kulturraum in der Frühen Neuzeit. Berlin: Logos. Reihe Germanistik in der Türkei, Bd. 17, 2022, 221 S. Rezensionen von Mieste Hotopp-Riecke erschienen in: „DAVO-Nachrichten“ Nr. 52/52, Mainz: University of Mainz, Dez. 2022, S. 184-189. (Als pdf hier und als jpeg zum download unten am Artikel-Ende) sowie in: Islamische Zeitung, Nr. 328, 13.10.2022 (online hier).
Ein Kompendium der tragischen Schicksale
Geschichte ist retrospektive Interpretation, die in uns, die im kollektiven Gedächtnis fortlebt. Dieses Fortleben der Interpretation vermag sich einerseits zu wandeln und progressiv zu wirken, birgt jedoch andererseits die Gefahr, geschichtsklitternd Gegenwart zu vereinnahmen. Dies illustriert als Standardwerk im besten, ersteren Sinne dieses Buch als Verneigung vor den orientalisch-deutschen Lebenswegen hunderter Zwangsmigrant*innen zwischen Fremdheit, Hoffnung, Gehen und Bleiben.
Was dies meint, verdeutlicht zum Beispiel der Gebrauch der Anführungszeichen in vorliegendem Band. Wenn anstatt von Türken ohne Anführungszeichen ausschließlich von „Türken“ in Anführungszeichen geschrieben wird, ist dies keine Lappalie oder eine Zumutung an die Leserschaft, sondern folgt hier stringent rezenten Ethnizitätsdiskursen. Denn während das Benutzen von Türkin, Türke oder Türken als nur eine Facette der Realität des osmanischen Vielvölkerreiches eine nicht vorhandene ethnische Homogenität vorspiegeln würde (und dies in eher nationalistischen Publikationen auch durchaus so intendiert ist), signalisieren die Anführungsstriche, dass eben nicht sicher zu eruieren ist, ob wir – in den Einzelfällen vorliegenden Handbuches zum Beispiel – von einem tscherkessischen Sipahi aus dem Kaukasus, einer kurdischen Marketenderin aus Aleppo, bulgarisch-stämmigen Janitscharen oder arabischen Söldnern aus Jemen oder dem Maghreb ausgehen können. Die Diversität des Osmanischen Vielvölkerstaates ist in den Taufeinträgen der letzten Jahrhunderte nicht abgebildet und dechiffrierbar.
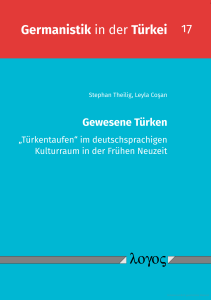
Diese Gänsefüßchenfrage ist also eine grundsätzliche und nicht zu unterschätzende, denn obige erwähnte retrospektive Interpretation von Geschichte fängt genau bei solchen Basisannahmen an, entweder progressiv zu wirken oder als eine nationalistisch verbrämte Sicht auf die Vergangenheit diese zu verfälschen. Ein Schüler, Student, Leser mit geringen Vorkenntnissen der multiethnischen osmanisch-deutschen Geschichte liefe Gefahr, rückblickend alle Kriegsgefangenen und später Getauften als Türken zu interpretieren, wie sie z.B. in der heutigen Turkologie definiert werden, nämlich als Angehörige eines Turkvolkes, die eine Turksprache sprechen und/oder sich einer türkischen Kultur zugehörig fühlen. Dies würde jedoch einer exkludierenden nationalistischen Sichtweise Raum bieten und die transkulturelle Kontaktzonengeschichte Eurasiens negieren anstatt Diversität und Komplexität von historischen Zusammenhängen aufzuzeigen.
Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn die beiden Autor*innen einführend schreiben, dass sie die Schreibweise „Türken“ bewußt gewählt hätten, auch um den Unterschied zum heutigen Begriffsverständnis zu verdeutlichen. Auch setzen sie damit einen Kontrapunkt zur vorherigen türkischen Ausgabe des Buches, in dem genau diesem diversifizierenden Ansatz weder durch Kennzeichnung gerecht werden konnte, noch der entsprechende Versuch einer Einordnung im Text unternommen wurde[1].
Und hier schließt sich eine weitere Leistung der akribischen Recherchearbeit von Leyla Coşan und Stephan Theilig an: Dieses Handbuch der „Türkentaufen“ ist nicht nur ein Zeugnis der Vergangenheit, eine Auflistung meist unangenehmer, gewaltsamer Geschichtsmomente, sondern fordert auf, heutige Identitätsdebatten und Ethnizitätsdiskurse zu befruchten, neu zu denken, zu erweitern. Denn ähnlich dem historischen Diskurs sind auch rezente Debatten gelagert – in der Türkei und in Deutschland. Wenn von einer Deutschen oder einem Deutschen die Rede ist, von einer Türkin oder einem Türken, etwa in den Nachrichten, in der Alltagssprache, in Statistiken und in anderen Feldern, was ist genau gemeint: Der Bundesbürger, also die Staatsangehörigkeit, oder die Nationalität? Hier dieses immense Feld aufzumachen oder auch nur die Diskurse herunterzubrechen, wäre anmaßend und ein nicht leistbares Unterfangen, jedoch ist es schlicht so, dass in Deutschland als auch in der Türkei neue Staatsbürgerschaftsmodelle, neue Sichtweisen und Bezeichnungen vor dem gleichen Hintergrund diskutiert werden. In der Bundesrepublik Deutschland ist es durchaus möglich, sich als Deutscher (Staatsangehöriger) und zugleich als Sorbe[2], Sinti, Roma, Däne oder Friese zu fühlen, zu bezeichnen, dies zu leben. Doch gilt dies neben diesen vier staatlich anerkannten autochthonen Volksgruppen[3] auch für die zahlenmäßig weitaus stärkeren Nationalitäten der Türken, Ukrainer, Kurden, Tataren oder Araber? Ebenso bildet sich die Nationalitäten- und Staatsbürgerschaftsdebatte in der heutigen Türkei ab: Meint also Türkin oder Türke sein immer ausschließlich die sprachlich-kulturelle Komponente von Ethnizität oder könnten sich Bulgaren, Kurden, Araber, Tscherkessen und andere Staatsbürger der Türkei nicht besser mit ihrem Staat identifizieren, wenn ein Stufenmodell allen die Teilhabe jenseits ethnisch-türkischer (und islamisch-sunnitischer) Zuschreibungen ermöglichen würde? Doch was sich in deutschen Abendnachrichten schwer durchzusetzen scheint, ist unter schwierigeren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Türkei sicher nicht leichter zu bewerkstelligen. Anstatt „türkisch“ steht dafür im Deutschen „türkeistämmig“ zur Verfügung, im Türkischen anstatt „Türk“ der Neologismus „Türkiyeli“, was mit „der Türkei zugehörig“ übersetzt werden kann[4].
Neben der Fülle an vordergründigen Daten, Fakten, bewegenden Schicksalen bietet dieses Handbuch also auch Stoff für interessante Ansätze in Diskussionen, in der Schule, der Universität oder den Medien, auch um alte Vorurteile abzubauen. In Zeiten von Globalisierung, grenzenlosem EU-Europa, aber auch von Rassismus, Antisemitismus und Abschottung ist dies nicht zu gering zu bewerten.
Denn analysiert man die deutschsprachige Literatur, so waren „die Türken“ – und mit ihnen „die Tartaren“ bzw. „die Muslime“ generell – im kollektiven Gedächtnis der Deutschen über Jahrhunderte furchterregende Fremde aus dem Südosten Europas bzw. Asien geblieben, mit denen man lediglich Vorstellungen von reitenden Horden, Kindsraub oder Unglaube verbindet. Erst spät ab dem 18. und vor allem 19. Jahrhundert wandelte sich dieses Bild und wurde durch ein nicht minder undifferenziertes Bild der „Türkenmode“, der exotisierenden „Turquerie“ ersetzt bzw. ergänzt[5]. Dass jedoch muslimische tatarische Armeen zusammen mit brandenburgisch-polnischen Heeren kämpften, türkische, bosnische und tatarische Soldaten in der preußischen, sächsischen oder polnischen Armee dienten, ja dass die ersten Muslime überhaupt, die nach Preußen als Diplomaten kamen, „Tataren“ und „Türken“ waren, wird weitestgehend ausgeblendet. Die turko-tatarische Kultur hinterließ zwar über die Jahrhunderte bis weit nach Mitteleuropa hinein Spuren in der Philologie, der Geistesgeschichte, der Botanik, der Gastronomie, der Musik und etwa der Militärtechnik und -garderobe, was aber nicht vermochte, die Inhalte und Formen althergebrachter Stereotypen über den „Erbfeind der Christenheit“ grundlegend zu revidieren.
Sind also die Türkenbilder von gestern relevant für die Auseinandersetzung mit Feindbildern von heute? In Deutschland? „Die fast zweihundertjährige Geschichte einer widersprüchlichen, unfertigen, von den Dämonen eines neurotischen Nationalismus getriebenen Volkes ist zu ihrem Ende gekommen; Nietzsches Diktum »Die Deutschen sind von vorgestern und von übermorgen – sie haben noch kein heute« gilt nicht mehr“[6] schreibt François in den „Deutschen Erinnerungsorten“. Für die Türkenbilder und/oder Stereotype über Muslime gilt dies wohl nur bedingt. Erinnerungsliteratur in deutscher Sprache, als welches auch vorliegendes Buch gelesen werden kann, in denen zum Beispiel Assimilation, Repression und Integration von Muslimen und „Türken“ thematisiert wird, ist ein weiterer Schritt in diese richtige Richtung, tragen zur Versachlichung von Geschichtsdebatten und der Relativierung einer alten Ikonografie der Angst vor dem vermeintlich Anderen bei[7].
Ferne und Nähe, Xenophobie und Respekt
Dass solch faktenbasierte Publikationen wie dies verdienstvolle neue Handbuch nützlich und nötig sind gerade seit der Zäsur des 11. September und folgender hysterischer Mediendebatten – gefolgt von einem erneuerten Generalverdacht allem „Fremden“ und „dem Islam“ gegenüber – kann nicht oft genug betont werden. In New York fanden damals Proteste für und wider das statt, was fälschlicherweise „die Moschee am Ground Zero“ genannt wird, jedoch in Realität ein islamisches Gemeindezentrum zwei Blocks entfernt von „Ground Zero“ ist. In Umfragen wurde deutlich, dass die Ablehnung des Projekts bei Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft – Manhattan – erheblich geringer war als in den Vororten Queens und Staten Island[8]. Diesen Zusammenhang von Ferne und Nähe zu kulturell, ethnisch oder religiös Anderen betont Regina Quinn auch, wenn sie auf das Beispiel der Volksabstimmung über das Minarettverbot im November 2009 in der Schweiz eingeht. Dort hätten vor allem die Menschen der ländlichen und alpinen Regionen für das umstrittene Verbot gestimmt – die Menschen in den kulturell und religiös vielfältigeren Ballungsräumen votierten größtenteils gegen das Verbot: „So unterschiedlich die Situationen sind, so deutlich ist, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt: Angst. Es ist Angst vor der Bedrohung durch einen radikalen und gewalttätigen Islamismus; es ist in gleicher Weise die Angst vor dem schlechthin Fremden; es ist die Angst vor »den Türken«, die, wie kürzlich zu lesen war, sich nicht integrieren wollen, die Ausbreitung der Unterschicht vorantreiben und pauschal mit dem „Islam“ identifiziert werden. Und es ist die Angst davor, dass die kulturelle Identität ins Wanken gerät und neu definiert werden muss.“ Ähnliche Szenarien spielten sich bezüglich etwa der Moschee-Projekte in Leipzig und Dresden ab, gefolgt von Farb- und Brandanschlägen auf dortige Moscheen[9] und dies korrespondiert frappierend – freilich jedoch nicht überraschend – mit den Erfahrungen, die die Projektarbeiten mit den sächsischen Nachbarn des Tatarengrabes in Kleinbeucha bei Leipzig zeitigten: Für die Dorfbewohner war und ist es selbstverständlich, seit über 200 Jahren das Grab des muslimischen Offiziers „Jussuf, Sohn des Mustafa“ zu pflegen und – auch muslimische – Gäste aus aller Welt dort am Grab willkommen zu heißen[10]. Wo man von gemeinsamer Geschichte weiß und Kontakte / Nahbeziehungen zu Menschen anderer Religion oder Nationalität pflegen kann, entstehen auch weniger Xenophobie, Menschenfeindlichkeit und Ablehnung von `Anderen`. Oder wie es Stefan Weber ausdrückte: „Migration ist die Mutter aller Kulturen“[11].
Dimensionen der Anschlußfähigkeit
So wäre eine denkbare und wünschenswerte Nutzung dieses Handbuchs, es als Landkarte der Möglichkeiten zu lesen: Ob in Magdeburg, Graz oder Düsseldorf, ob an der Spree oder der Donau, das Buch wird sich als Quellen-Kompendium exzellent für mehrsprachige Jugend-Geschichtswerkstätten, für regionalhistorische Geo-Caching-Streifzüge etwa im Rahmen von Projekttagen oder CrossMedia-Workshops nutzen lassen, vor allem auch in ländlichen Räumen, da nicht nur Metropolen als Tauf-, Wirkungs- und Sterbeorte der „Beutetürken“ erfasst wurden, sondern explizit auch Dörfer und Kleinstädte.
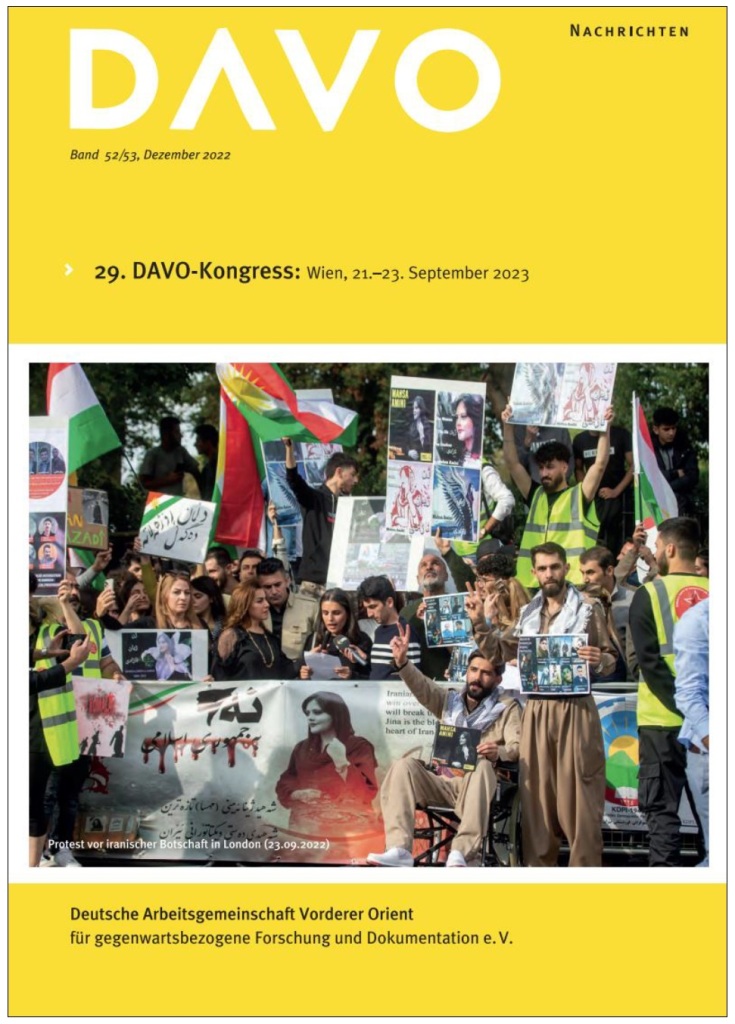
Dieses Sachbuch kann ergo einen Beitrag leisten nicht nur zur historischen Faktenlage sondern auch zu einer weitergehenden Neubewertung türkisch-deutscher bzw. osmanisch-deutscher Beziehungsgeschichte, einem aufmerksameren Umgang mit xenophoben Stereotypen und einem Blick auf Europa und Eurasien ohne EU-Scheuklappen, jedoch mit diversitätsbewusstem Ansatz, sei es in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (den Kinder-Kanal von ARD/ZDF explizit eingeschlossen), in der Wissenschaft oder der Literatur, um zu einer Versachlichung der rezenten Islam-Angst-Debatten in Westeuropa beizutragen.
„Europa und der Islam teilen eine wechselvolle Geschichte, die durch historische Kontakte vor allem an Europas Südwest- und Südostflanken geprägt ist. Der Islam diente Europa Jahrhunderte lang als diskursives Anderes. Europäische Christen grenzten sich ideologisch und kriegerisch vom Islam ab, gleichzeitig aber hat kaum eine fremde Kultur die europäische Geistes- und Kunstgeschichte stärker beeinflusst als die muslimische.“[12] Dieses Zitat steht geradezu symptomatisch für den EU-Eurozentrismus vieler Autor*innen, die sich mit Islam, Europa und Vielfalt auseinandersetzen. Was zeigt dieses Zitat? Selbst Autor*innen, deren Anliegen es ist, für Ausgleich, Diskussion und Akzeptanz dem Islam gegenüber zu werben, gelingt es nicht, die eigenen Schemata im Kopf abzulegen. Islam ist auch für sie in `Europa` eine `fremde Kultur` und dieses Europa endet scheinbar für die meisten hinter den Masuren, irgendwo dort hinten Richtung Belarus und Ukraine oder spätestens auf dem Balkan. So heißt es im Handbuch Islam: „Es fällt den europäischen Gesellschaften schwer, die Muslime in ihrer Mitte als Muslime aufzunehmen. Dabei rufen die Kopftücher, die zu tragen manchen Musliminnen als eine religiöse Pflicht erscheint, besonders leidenschaftlichen Widerstand hervor. Sie sind das sichtbarste Zeichen dafür, dass unsere säkularen Gesellschaften, die seit dem 19. Jahrhundert ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der Öffentlichkeit und den christlichen Konfessionen sowie dem Judentum erarbeitet haben, heute vor der Notwendigkeit stehen, auch für den Islam einen Raum schaffen. Innerhalb dessen er bei uns leben kann.“[13] Bei „uns“ wird hier gleichgesetzt mit „europäisch“, der Islam ist das Andere, das Gegenüber trotz alledem.
Als eine weitere Dimension, die dieses Buch aufzumachen im Stande ist, bietet sich die der Langen Dauer der Integrationsleistungen der „Türken“ an, die sie im Kontext von friedlicher Koexistenz, von reziproker Akkulturation, von Handel und Wirtschaft in den letzten Jahrhunderten erbracht haben und das ihnen immanente Potential für eine positive Befruchtung des Euro-Islam-Diskurses und der „Stärke durch Vielfalt“-Debatten in West-Europa an, die bisher völlig unterbewertet sind. Es bleibt ergo zu diskutieren, inwiefern die Ignoranz dieses Potentials – historisch die Leistungen der „Beutetürken“ wie zeitgeschichtlich die der „Gastarbeiter“ – auch mit imaginierten Ost-West-Dichotomien und womöglich Nachwirkungen einer alten Ikonografie der Angst korrespondieren.
„Damit wir uns nicht falsch verstehen: Es gibt im deutschen Journalismus viele gute Artikel und einzelne Radio- und Fernsehsendungen. Auch viele Kritiker des Feindbildes Islam kommen zu Wort. Aber an der thematischen Grundstruktur und an der nachhaltigen Ausrichtung der Medienbeachtung auf den Gewaltkomplex hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte wenig geändert.“Das Islambild deutscher Medien würde heute noch mehr einer Art »aufgeklärten Islamophobie« ähneln, schätzt Kai Hafez in seinem Artikel ein[14]. So lange aber die Menschen tagtäglich mit einem Negativbild des Islams bzw. mit der ihm gleichgesetzten Ethnizitäten wie der „Türken“ konfrontiert werden und Positivbilder wie der des autochthon-europäischen z.B. türkischen, tatarischen oder bosnischen Islam weitestgehend ignoriert werden, obwohl diese sicher positives bewirken könnten, solang „helfen Appelle an Respekt und Toleranz wenig, weil die Agenda des islamophoben Denkens alles überwiegt.“. Freilich, man solle die Wirkung von Massenmedien nicht überschätzen, denn „sie prägen eben nicht die Identität des Menschen, aber sie prägen in hohem Maße das Bild, das sich ein Mensch von einer Fremdgruppe macht, so dass von einer Ausbalancierung des Medienbildes sicher positive Impulse für den sozialen Frieden zu erwarten wären.“[15] schreibt Hafez weiter. Schaut man nun in die deutsche Literatur aber auch in die Veröffentlichungen von Bassam Tibi, Naika Foroutan, Florian Remien und vielen anderen, stellt man fest, daß mit Euro-Islam oder Islam in Europa eben nur in Ausnahmefällen der originäre autochthone Islam im Osten oder Süden unseres Subkontinentes, sondern der Post-Migranten-Islam von Westeuropa thematisiert wird[16], ja meistens `Europa` generell schon als mit der EU synonym gebraucht wird.
Eine Hypothese meiner Untersuchungen von vor 15 Jahren kann[17], wenn man auf die Gesamtheit aller rezenten Fremdheitsbilder der letzten beiden Jahrhunderte blickt, als bestätigt gelten: Die Fremdbilder von Türken, Tataren, Muslimen wurden zwar im Laufe der letzten Jahrhunderte von Faktoren wie direkter Kulturkontakte (Armeedienst, Einquartierung, Migration, Handelsreisen) beeinflusst, eine generelle Revision der überlieferten Vorurteile und Stereotype aber fand nur partiell oder nicht statt – bis heute nicht. Diese longue durée der negativen Stereotype des `Anderen` implizieren mehr `Urängste` in der kollektiven Erinnerung des Eigenen als das sie aussagefähig sind über eine Alterität, das Gegenüber.
Für die Fortsetzung von Arbeiten zur Überwindung althergebrachter Vorurteile ist dieses Handbuch ein fabelhaftes Werkzeug, ob in der Wissenschaft, der kulturellen Bildung oder in internationalen Austauschprojekten, denn letztere Möglichkeit und Notwendigkeit sollte nicht unterschätzt werden: Gerade Orte mit bitterer Geschichte von Krieg und Vertreibung wie das russländische Kaliningrad, ehemals Königsberg, Stettin (polnisch Szczecin), Gorzów Wielkopolski (ehem. Landsberg a.d. Warthe), aber auch die Orte der Gefangennahme zwischen Budapest, Belgrad und dem Peleponnes laden ein zu internationalen Projekten, Workshops oder Forschungsreisen.
Die gelisteten „Türkentaufen“ dieses Handbuches vermögen ebenfalls dazu beizutragen – so bitter jedes einzelne Schicksal der „Beutetürk*innen“ auch war – , differenzierten Bildern Raum zu geben im Kontext gewaltsamer Integration als gesellschaftlicher Realität der Vergangenheit sowie als zäh erarbeitete Errungenschaft des 21. Jahrhunderts die Selbstanerkennung der bundesrepublikanischen Gesellschaft als einer der Vielfalt, einer Einwanderungsgesellschaft, die nicht mehr vor allem nur durch Zwangsmigration, Militär und Krieg gekennzeichnet ist: „Ein muslimischer Friedhof mitten in Brandenburg, auf dem aber auch Christen, Hindus und Sikhs bestattet worden sind. Das so was möglich ist und sogar bereits möglich war, klingt heutzutage fast ein bisschen utopisch.“[18] Der deutsch-türkische Erinnerungskomplex der „Türkentaufen“ und die Beschäftigung mit gemeinsamer türkisch-deutscher Geschichte und Kultur geben Anlass zur Hoffnung und bieten weiterhin ein fruchtbares Forschungsfeld für Historiker, Islamwissenschaftler, Turkologen und andere Geisteswissenschaftler.
Im Sinne von Etienne François und Hagen Schulz[19] können die wenigen nach wie vor existenten Gräber, Grabmale und Gedenksteine für „Beutetürken“ einerseits als sichtbare, fassbare Erinnerungsorte im öffentlichen Raum gelten, die bereits durch ein Miteinander von türkeistämmigen und regionaler alteingesessener Bevölkerung bei Aufarbeitung, Pflege und Gedenken konkrete Änderungen im regionalen Türkenbild bewirken. Andererseits – im Falle der diversen nicht mehr existenten, unsichtbaren Erinnerungsorte, hier im Buch verewigt – mahnen sie die Überwindung der Zählebigkeit imaginierter kollektiver Ängste an, die teils nach wie vor fester Bestandteil der Erinnerungskultur eines Teiles der deutschen Bevölkerung geworden sind.
Freilich ist diese erste umfassende Analyse von „Türkentaufen“ in der deutschen Fachliteratur nicht der Nabel der wissenschaftlichen Welt, weder der migrationswissenschaftlichen, turkologischen noch islamwissenschaftlichen. Jedoch wird es als anregende Basis helfen, den gesellschaftlichen Diskurs über Fremde, insbesondere über vorgestellte Ost-West-Dichotomien mit Fakten zu flankieren und mag es als Lackmustest für eine moderne aufgeklärte und neutrale Umgangsweise mit Stereotypen und Vorurteilen über die vermeintlich `Anderen` taugen. Die Aufmerksamkeit für das Thema „Türkentaufen“ kann als Indikator dafür gelten, inwiefern in unserer Mediengesellschaft und als Abbild dieser in Literatur, Publizistik und Schulbuchmedien mit ethnischer und religiöser Diversität in Vergangenheit und Gegenwart sowie vorgestellter ethnisch homogener Konstruktionen von Gesellschaften verantwortlich umgegangen wird.
Gerade in diesen Monaten, wo sich die Mordanschläge von Solingen, Mölln, nun eingereiht auch Hanau und Halle jähren, wird erneut deutlich, wie notwendig faktenbasierte Debatten über Menschenfeindlichkeit, Rassismus und Nationalismus sind – einerseits. Es sind jedoch auch Zeiten – andererseits -, in denen erstmals in der Geschichte Deutschlands mit Aydan Özoğuz eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und mit Cem Özdemir ein Bundesminister türkische und tscherkessische Lebenswege[20] als Normalität in der bundesdeutschen Einwanderungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts widerspiegeln.
Alle Möglichkeiten des Einsatzes dieses neuen Buches in den Blick genommen, ist dem Werk zu wünschen, dass dieses Kompendium der tragischen Schicksale auch als Vermächtnis der Hoffnungen vieler unserer gemeinsamen Vorfahren gelesen, genutzt und erweitert werden möge.
Mieste Hotopp-Riecke,
Avola, Sizilien, und Hiddensee, Winter 2021/Frühling 2022
[1] Coşan, Leyla / Theilig, Stephan: Esaretten Vaftize: 16. ve 18. Yüzyıllarda Almanya’da Türk Savaş Esirleri. Istanbul: Yeditepe, 2018, 214 S.
[2] Vgl.: Luise Mosig: Staatsangehörigkeit: Deutsch, Nationalität: Sorbisch. In: Luhze. Leipziger unabhängige Hochschulzeitung. Leipzig, Nr. 145, Juno 2019, S. 3, online unter URL: https://www.luhze.de/2019/06/28/staatsangehoerigkeit-deutsch-nationalitaet-sorbisch/ [20.05.2021].
[3] Die anerkannten nationalen Minderheiten der BRD sind „Die Lausitzer Sorben, die dänische Minderheit, die deutschen Sinti und Roma sowie die friesische Volksgruppe“ (Ostfriesen, Sater-Friesen, Nordfriesen, d.A.), vgl.: https://www.minderheitensekretariat.de/ [12.10.2021].
[4] Grigoriadis, Ioannis: Türk or Türkiyeli? The Reform of Turkey´s Minority Legislation and the Rediscovery of Ottomanism. In: Middle Eastern Studies, Vol. 43, Nr. 3, S. 423-438, Mai 2007 (online unter URL: https://www.jstor.org/stable/4284553 [22.10.2021]). Gegenposition z.B. von Ortaylı, İlber: Türkiyeli diye bir ırk yoktur. Türk vardır. (Eine Rasse namens Türkiyeli gibt es nicht. Türken gibt es!), In: Hürriyet, 8.9.2017, online unter URL: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ilber-ortayli-tabulara-comak-sokamazsiniz-40573336 [1.3.2021].
[5] Vgl.: Williams, Haydn: Turquerie. An Eighteenth-Century European Fantasy. London: Thames & Hudson, 2014.
[6] François, Etienne / Schulze, Hagen: Deutsche Erinnerungsorte. Eine Auswahl. München: C.H. Beck, 2005.S. 10.
[7] Kirsch, Guy (Hrsg.): Angst vor Gefahren oder Gefahren durch Angst? Zur politischen Ökonomie eines verdrängten Gefühls. Zürich: nzz-libro / Buchverlag Neue Zürcher Zeitung, progress, 2005; Binder, Beate / Kaschuba, Wolfgang / Niedermüller, Peter: Inszenierungen des Nationalen. Geschichte, Kultur und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhunderts. Köln: Böhlau, Alltag & Kultur, 2006; s.a: Hotopp-Riecke, Mieste: Ikonographie der Angst. Deutsche Tatarenbilder im Wandel: Barbaren, Alliierte, Migranten. Berlin: Verlag Freie Universität, Dissertationsschrift 2011, 418 S.
[8] Ammicht Quinn, Regina: Sind interreligiöse Bewegungen politisch relevant? Offene Gesellschaft, religiöse Vielfalt. In: Zimmermann, Olaf / Geißler, Theo (Hrsg.): Aus Politik & Kultur. Islam.Kultur.Politik. 11/2011, S. 200.
[9] Bzgl. Sprengstoffanschlag auf die DITIB Fatih-Moschee in Dresden am 26. September 2016 s.: „Diesen Anschlag werde ich nie vergessen“, In: Mete, Ali (Red.): IslamiQ, Köln, 26.9.2020, online unter URL: https://www.islamiq.de/2020/09/26/diesen-anschlag-werde-ich-nie-vergessen/ [12.11.2021].
[10] Dazu Hotopp-Riecke, Mieste: Zur Rolle der Tatarengräber Mitteldeutschlands als deutsch-tatarischen Erinnerungsorten. In: Hotopp-Riecke, Mieste / Theilig, Stephan (Hrsg.): Fremde, Nähe, Heimat. 200 Jahre Napoleon-Kriege: deutsch-tatarische Interkulturkontakte, Konflikte und Translationen. Berlin: Business, 2014, S. 59-83.
[11] Prof. Dr. Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin, über die Ausstellungen der islamischen Kunst in Deutschland, Migration und Kulturvermittlung. In: Mete, Ali (Red.): IslamiQ, Köln, 4.12.2021, online unter URL: https://www.islamiq.de/2021/12/04/migration-ist-die-mutter-aller-kulturen/ [7.12.2021].
[12] Dies sind die ersten Sätze aus einer Konferenzankündigung von 2009 „Herausforderung Islam: Autorität, Religion und Konflikt in Europa„. Das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Arbeitsgruppe „Europas Andere – andere Europas“ lud zu diesem öffentlichen Symposium am 5. und 6. Juni 2009 ein. Mehr Informationen online unter URL: http://idw-online.de/pages/de/event27459 [22.3.2021].
[13]Hottinger, Arnold: Anpassung für Europas Muslime? – Zur Debatte um Kopftücher, Friedhöfe und Moscheen. In: (Weiss, Walter M.) Dumonts Handbuch ISLAM. Köln: Du Mont monte, 2002, 222-229, hier S. 222.
[14] Hafez, Kai: Aufgeklärte Islamophobie. Das Islambild deutscher Medien. In: (Zimmermann, Olaf / Geißler, Theo) Islam – Kultur – Politik. Dossier zur Politik und Kultur. Regensburg: ConBrio / Deutscher Kulturrat e.V., Januar-Februar, 2011, S. 25.
[15] Ebd., S. 25.
[16] Remien, Florian: Muslime in Europa: Westlicher Staat und islamische Identität. Untersuchung zu Ansätzen von Yūsuf al-Qaraḍāwī, Tariq Ramadan und Charles Taylor. Bonn: EB, Bonner islamwissenschaftliche Hefte (BiH), 3, 2007; Foroutan, Naika / Schäfer, Isabel: Hybride Identitäten – muslimische Migrantinnen und Migranten in Deutschland und Europa. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 26. Januar 2009 (5/2009), 2009, 11-18; Tibi, Bassam: Euro-Islam: die Lösung eines Zivilisationskonflikts. Darmstadt: Primus, 2009.
[17] Hotopp-Riecke 2011, vgl.: Fn. 6 in „Einleitung“ Theilig/Coşan 2022, S. 6.
[18] In der Sendung von DeutschlandRadio Kultur „Nicht Mekka, sondern Zehrensdorf“, online unter URL: https://www.deutschlandfunkkultur.de/nicht-mekka-sondern-zehrensdorf-100.html/ [16.4.2021].
[19] François, Etienne / Schulze, Hagen: Deutsche Erinnerungsorte. München: C.H. Beck, Bd. 1-3, 2003.
[20] Der ehemalige Co-Vorsitzende der bundesdeutschen Partei Bündnis 90 / Die Grünen ist seit dem 8. Dezember 2021 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Seine Eltern Nihal und Abdullah sind türkischer und tscherkessischer Herkunft. Vgl.: Taştekin, Akanda: Interview mit Cem Özdemir. Mein Vater war ein Tscherkesse. In: Jineps. Die freie Stimme der Tscherkessen. Okt. 2020, S. 6; online unter URL: https://www.oezdemir.de/2020/10/13/interview-mein-vater-war-ein-tscherkesse/ [22.11.2021].